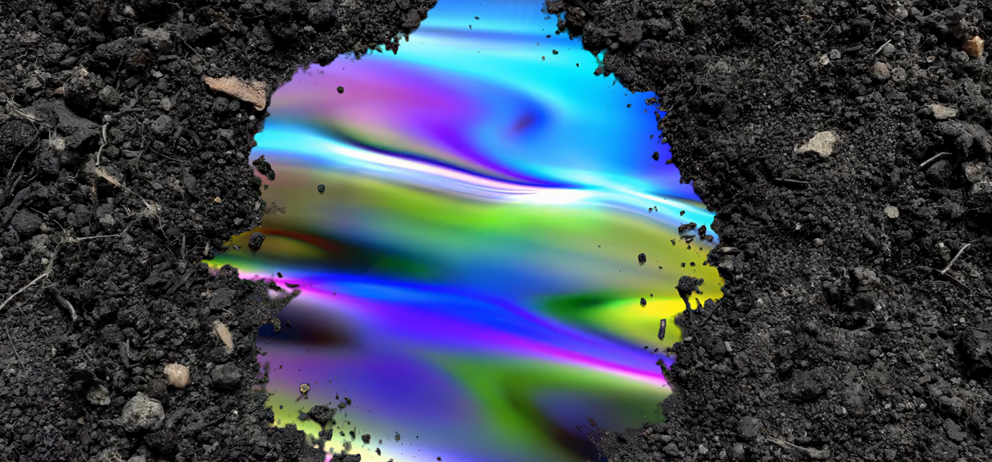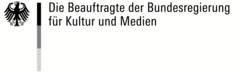Die Veranstaltung fand am 9.10.2025 im HAU1 statt.
Eine Mehrheit internationaler Expert*innen, Rechtswissenschaftler*innen, Historiker*innen und Menschenrechtsorganisationen, darunter auch die UN-Kommission, bezeichnen den israelischen Angriff auf Leben, städtische Strukturen und Lebensgrundlagen in Gaza als Völkermord. Die Gewalt und Zerstörung nach dem mörderischen Angriff der Hamas haben ein Ausmaß erreicht, wie es in der jüngeren Geschichte nur selten vorkam. Dennoch entfacht die Debatte über die Anwendbarkeit des Begriffs “Genozid” in Deutschland nach wie vor hitzige Diskussionen in juristischen, politischen und akademischen Kreisen. Die Diskussion am HAU versucht, in diese Debatte einzugreifen, indem sie eine Analyse der umfangreichen Faktenlage zur Situation vor Ort in Gaza liefert und den Angriff in die Geschichte der Völkermorde seit der Einführung des Völkerrechts nach dem Holocaust einordnet.
Die Debatte darüber, ob die Handlungen Israels einen Genozid darstellen, ist jedoch nicht nur eine Frage der Terminologie: Staaten, die die Völkermordkonvention ratifiziert haben, sind nicht nur verpflichtet, solche Verbrechen selbst zu unterlassen, sondern sie auch anderswo zu verhindern und zu bestrafen. Anstelle von Prävention sehen wir, dass diese Verbrechen im Gegensatz zur Zerstörung von Aleppo oder Grosny mit logistischer, militärischer und diplomatischer Unterstützung der meisten westlichen Länder, vor allem der USA und Deutschlands, durchgeführt wurden. Dies setzt die internationale Ordnung unter massiven Druck: Was geschieht mit dem Status des Völkerrechts, wenn seine Durchsetzung abgelehnt oder ignoriert wird? Wie kann die Rechenschaftspflicht von Staaten angesichts ihrer Mittäterschaft am Völkermord gewährleistet werden?
Der palästinensische Völkerrechtsexperte Ahmed Abofoul und der israelisch-amerikanische Völkermordhistoriker Omer Bartov werden ihre fachlichen Perspektiven einbringen, um die aktuellen Debatten in einen breiteren historischen und rechtlichen Kontext zu stellen.
Das Gespräch wird moderiert von der Völkerrechtlerin Chantal Meloni und der Historikerin Stefanie Schüler-Springorum und wurde in Zusammenarbeit mit Berlin Review, ECCHR und dem HAU Hebbel am Ufer organisiert.
Mit:
Ahmed Abofoul ist ein in Gaza geborener internationaler Jurist und Rechtsberater bei der Nichtregierungsorganisation für Menschenrechte Al-Haq Europe. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und der internationalen Gerechtigkeit auf nationaler und internationaler Ebene.
Omer Bartov ist Historiker und Professor of Holocaust and Genocide Studies an der Brown University in Providence, USA. Er zählt zu den führenden Genozid- und Holocaustforscher. Sein letztes Buch “Genozid, Holocaust und Israel-Palästina, Geschichte im Selbstzeugnis” erschien auf Deutsch im April 2025 im Suhrkamp Verlag.
Chantal Meloni ist Rechtsanwältin und Professorin an der Universität Statale in Mailand, wo sie internationales Strafrecht lehrt. Sie ist Autorin mehrerer international veröffentlichter wissenschaftlicher Bücher und Artikel und war am Internationalen Strafgerichtshof tätig. Seit 2010 berät sie das Palestinian Centre for Human Rights. Seit September 2015 unterstützt sie als Senior Legal Advisor den ECCHR-Programmbereich Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung.
Stefanie Schüler-Springorum ist Historikerin und seit 2011 Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind deutsche und jüdische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Geschlechtergeschichte und spanische Geschichte.